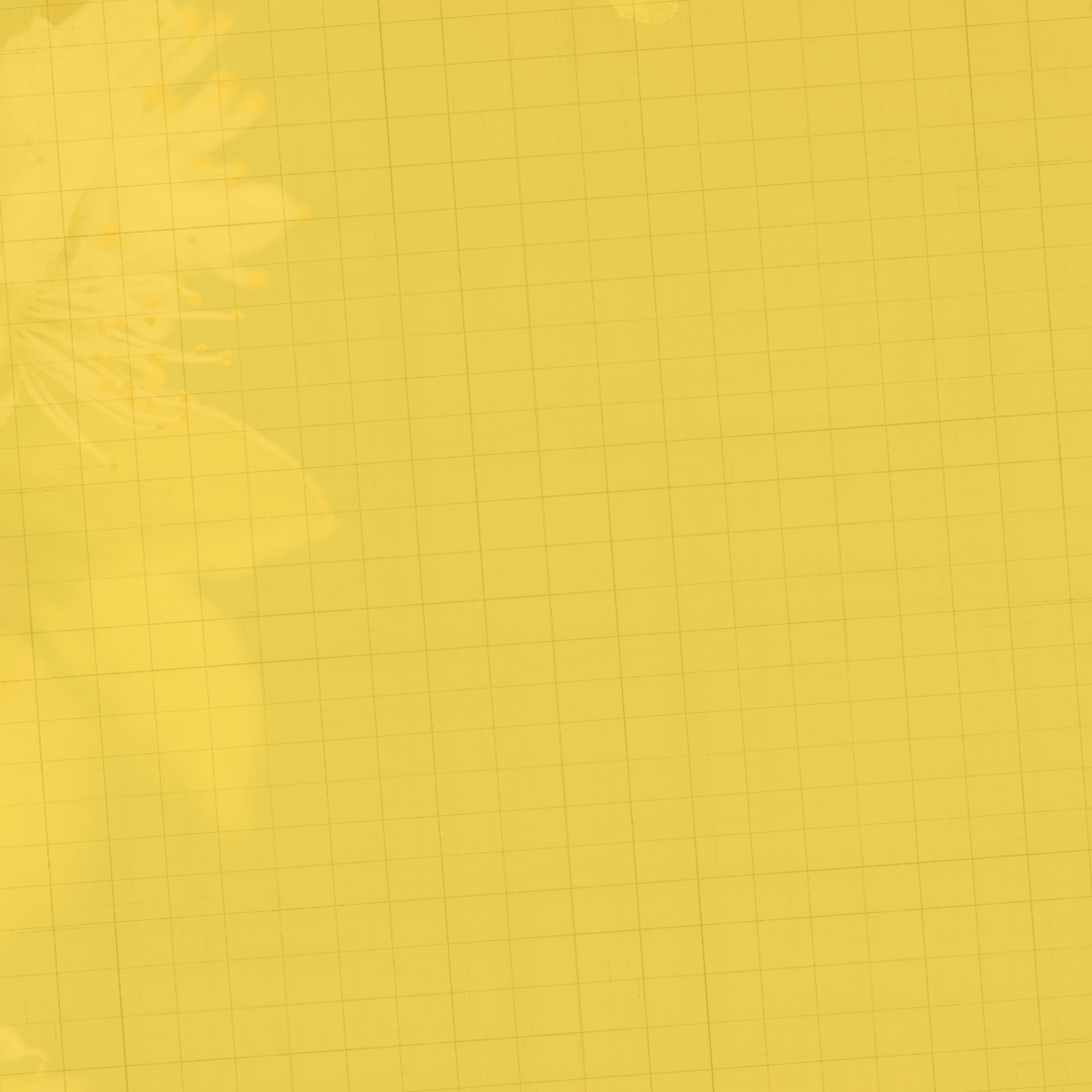
Ist Rhythmus eine universelle Fähigkeit?


Rhythmus ist tief in unserem menschlichen Erleben verankert: Schon bei Neugeborenen lässt sich beobachten, dass sie auf regelmäßige Klangmuster reagieren und Abweichungen im Tempo wahrnehmen (Hannon & Trehub, 2005).
Dieses frühe Ansprechen auf rhythmische Impulse deutet darauf hin, dass Rhythmuswahrnehmung eine biologische Grundlage hat, die weltweit bei allen Menschen zu finden ist (Phillips-Silver & Trainor, 2005).
Unser Gehirn erkennt also spontan zeitliche Muster und wir passen uns – z. B. durch Mitwippen oder Tanzen – intuitiv einem Takt an. (Fischinger, 2012).
Auch körperliche Rhythmen wie der Herzschlag oder die Atmung tragen dazu bei, dass wir im Außen (Musik, Tanz) zyklische Strukturen auf natürliche Weise wahrnehmen und umsetzen (Large & Kolen, 1994).
Gleichzeitig zeigen sich in verschiedenen Kulturen ganz unterschiedliche Rhythmuskonzepte.
In westlicher Popmusik wird oft ein gerader 4/4-Takt dominiert
In afrikanischen Trommelensembles sind oft Polyrhythmen üblich
im südosteuropäischen Raum begegnet man häufig ungeraden Taktarten
Diese Vielfalt verdeutlicht, dass die grundlegende Fähigkeit zur Rhythmusverarbeitung zwar universell ist, die konkrete Ausgestaltung jedoch stark kulturellen Einflüssen unterliegt (Clayton, Dueck, & Leante, 2020).
Selbst innerhalb einer Kultur variiert das Geschick im Umgang mit Rhythmus – manche Menschen bleiben mühelos im Takt, andere tun sich schwerer. In extrem seltenen Fällen („Beat Deafness“) ist es sogar unmöglich, sich an einen Beat anzupassen (Palmer & Lidji, 2013).
Insgesamt lässt sich also sagen: Wir alle tragen ein gemeinsames, biologisch begründetes „Rhythmus-Potenzial“ in uns, doch wie es ausgeprägt und gelebt wird, hängt stark von unseren kulturellen Erfahrungen und individuellen Talenten ab.
fertig lesen?
Gemeinsamer „Groove“ vs. persönlicher Ausdruck gibt es ein Zusammenspiel(en)?
du möchtest mehr erfahren?
dann meld dich jetzt zu unserem Newsletter an
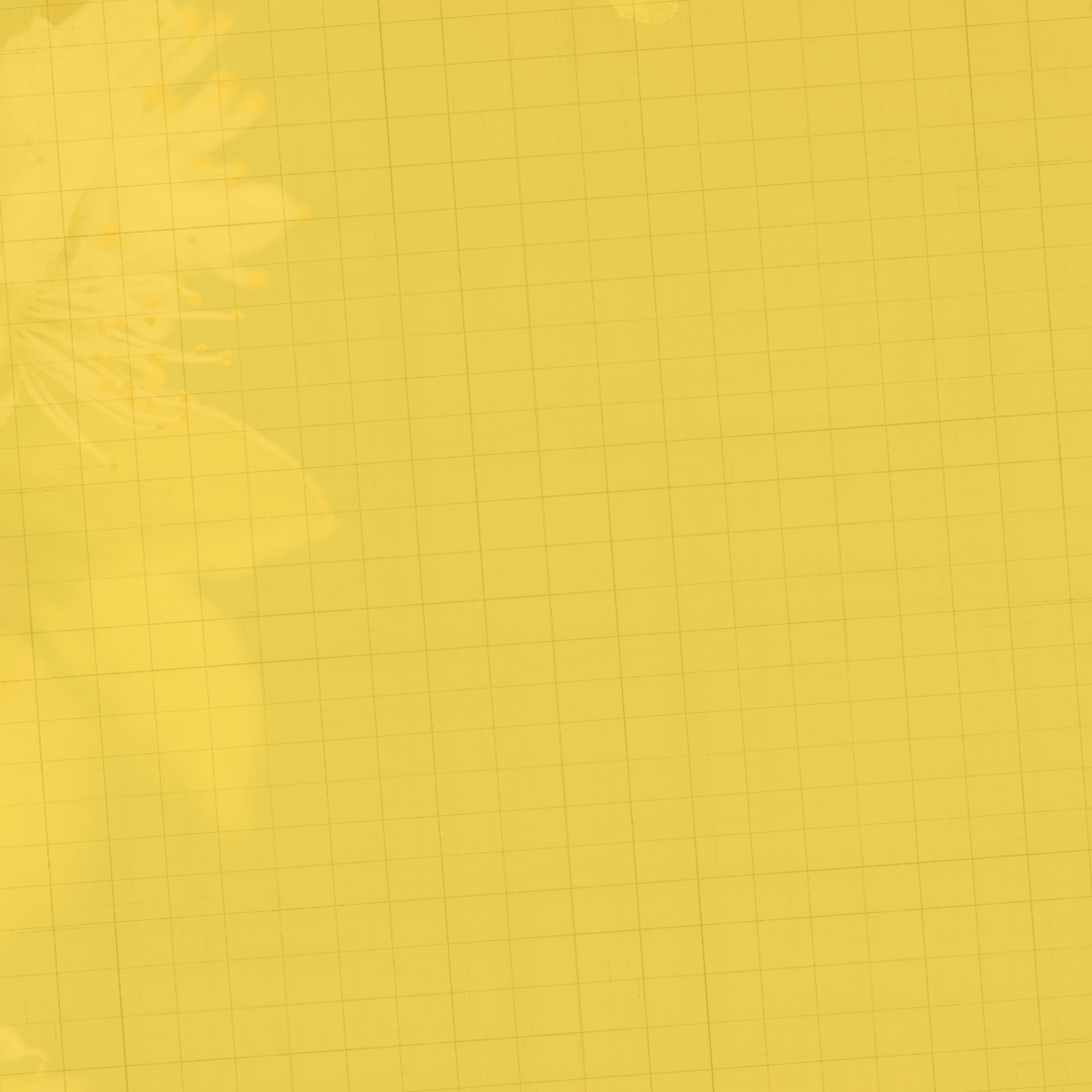
Verbindung
Kreative Plattform für Kunst und Austausch.
© 2024. All rights reserved.
weitere Infos folgen - so weit sind wir noch nicht


