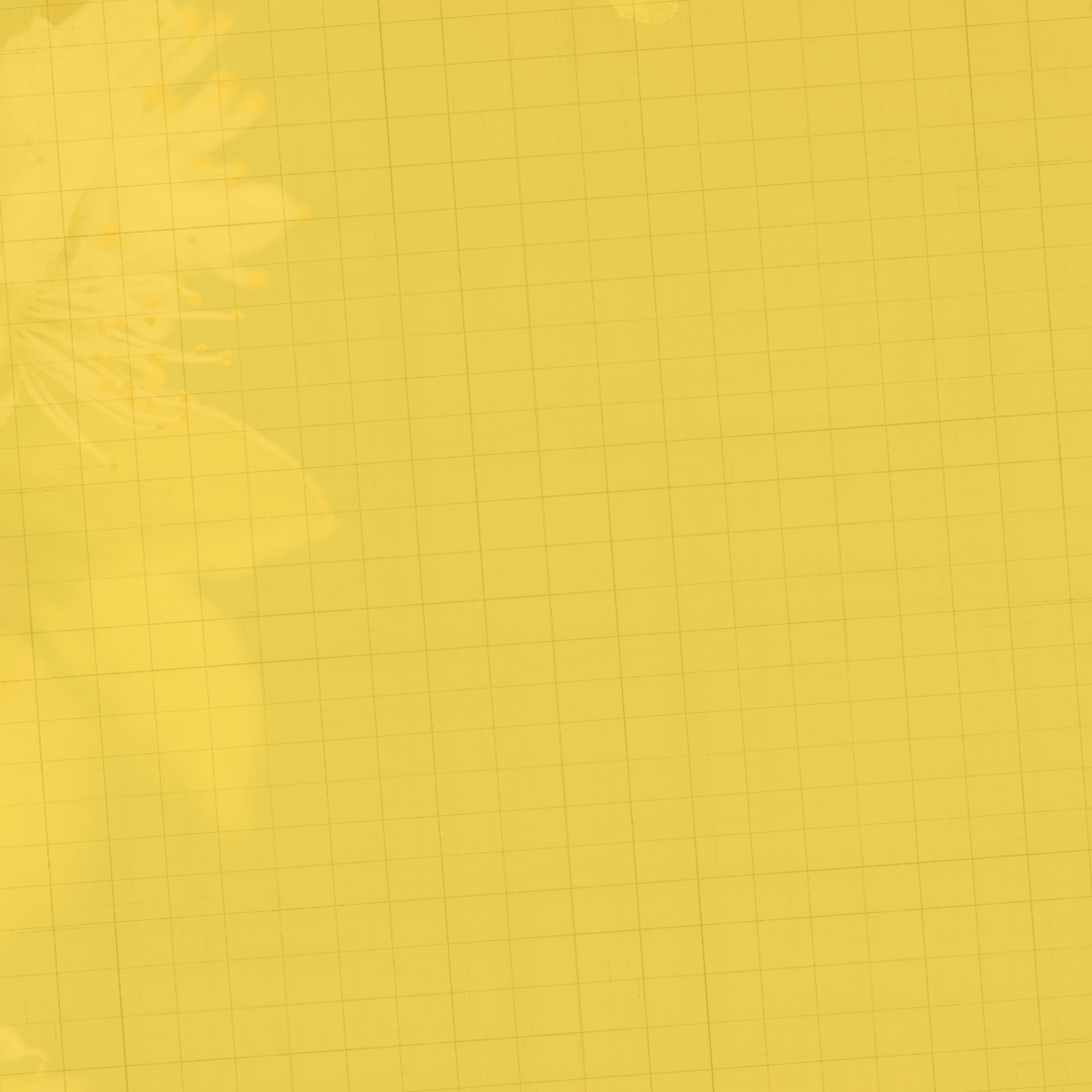
Scheitern - "Ich scheitere gerne?"


Scheitern ist meist keine angenehme Erfahrung. Es ist häufig begleitet von Scham, Selbstzweifeln oder Angst. Trotzdem kann Scheitern produktive Effekte haben, wenn es als Chance begriffen wird, zu lernen und sich weiterzuentwickeln
Psychologische Perspektive: Scheitern als Entwicklungsschritt
⁃ Lernchance
Misserfolge zwingen zur Reflexion – man kann Ziele anpassen, Werte neu ausrichten oder sein eigenes Handeln verbessern
⁃ Growth Mindset vs. Fixed Mindset
o Mit einem Growth Mindset (Dweck) sieht man Scheitern als Lern-Etappe.
o Mit einem Fixed Mindset empfindet man es hingegen schnell als Beweis eigener Unfähigkeit.
⁃ Stress- und Krisenbewältigung
Scheitern kann Krisen wie Burnout verstärken, aber auch zu Resilienz führen, wenn man geeignete Coping-Strategien (z. B. Coaching, soziale Unterstützung) nutzt
Wie konstruktiv umgehen?
⁃ Assimilation vs. Akkommodation
o Assimilation: Ziel beibehalten, neue Strategien suchen.
o Akkommodation: Unerreichbares Ziel loslassen, ggf. umdeuten.
⁃ Positives Potenzial:
Scheitern durchbricht Routinen, kann zu innovativen Ideen führen, das Selbstkonzept verändern
⁃ Praktische Tipps:
o Ziele realistisch und schrittweise definieren
o Bei offenkundig aussichtsloser Lage rechtzeitig korrigieren oder abschließen
o „Was kann ich daraus lernen?“ statt „Ich bin unfähig.“
Beispiel: Prüfungsangst
⁃ Angst als Risikofaktor für Scheitern
Hohe Prüfungsangst bindet kognitive Ressourcen, verringert Selbstvertrauen und kann dazu führen, dass Betroffene öfter scheitern
⁃ Konkrete Interventionen:
o Progressive Muskelrelaxation (PMR) senkt körperliche Erregung.
o Positive Selbstverbalisation (PSV) transformiert negative Gedanken in konstruktive Aussagen.
→ Indirekt senken solche Methoden die Gefahr, dass man in Prüfungen „versagt“.
Kurz: „Ich scheitere gerne?“ – Natürlich gern niemand. Aber wer es schafft, Scheitern als Lern- und Entwicklungsimpuls zu betrachten, kann langfristig profitieren
Beispiel: Schwimmer und Misserfolg
Seligmann et al. (1976) und KollegInnen zeigen in Studien, dass diese Auslegungen von Misserfolg auch einen Einfluss auf die Leistung von Profi-Schwimmern haben.
⁃ Schwimmer mit einem optimistischen Erklärungsstil zeigen bessere Leistungen als solche mit einem pessimistischen.
⁃ Die Schwimmer mit einer pessimistischen Wahrnehmung performten eher unter den Erwartungen.
⁃ Nach einem Rückschlag entwickeln diese eher Einbrüche in ihren Leistungen, Schwimmer mit einer optimistischen Ansicht jedoch nicht.
Diese Kenntnisse können für Coaches wichtig sein. Vor allem, wenn es darum geht zu entscheiden, ob Athleten nach einem Rückschlag oder bei wichtigen sportlichen Events eingesetzt werden. Schwimmer mit optimistischen Erklärungsstilen können im Durchschnitt unter Druck bessere Leistungen zeigen
Nach der „Theorie der Erlernten Hilflosigkeit“ führt die Erwartung eines zukünftigen Misserfolges dazu, dass weniger Anstrengungen unternommen werden und dadurch wird dann auch ein Misserfolg wahrscheinlicher.
Hier kann Optimismus ein spannendes Tool sein.
Also
⁃ Scheitern ist hochgradig mehrdimensional und inhaltlich wie kulturell geprägt.
⁃ Ob man etwas als „gescheitert“ empfindet, hängt von Zieldefinitionen, Erwartungen und sozialer Akzeptanz ab.
⁃ In den USA wird Scheitern häufig als normaler Bestandteil des Innovations- und Lernprozesses betrachtet („Fail fast, fail forward“), während in anderen Kontexten starkes Stigma besteht.
⁃ Wichtig ist, nicht in Schuld oder Scham stecken zu bleiben, sondern die Erfahrung zu reflektieren und konstruktive Strategien abzuleiten. So kann Scheitern zu persönlichem und beruflichem Wachstum führen.
Scheitern ist kein Endpunkt – richtig verarbeitet, eröffnet es neue Wege und Perspektiven.
Literatur
Brandtstädter, J. (2006). Das flexible Selbst: Selbstentwicklung zwischen Zielbindung und Ablösung. Spektrum Akademischer Verlag.
Dörner, D. (1992). Die Logik des Misslingens: Strategisches Denken in komplexen Situationen. Rowohlt.
Dweck, C. S. (2006). Mindset: The New Psychology of Success. Random House.
Jackson, T. (2016). Reconstructing the entrepreneurial failure process: A phenomenological approach. International Small Business Journal, 34(5), 567–588.
Maitz, J. (2012). Überprüfung von Interventionsmaßnahmen zur Reduktion von Prüfungsangst [Diplomarbeit, Universität Graz].
McGrath, R. G. (1999). Falling forward: Real options reasoning and entrepreneurial failure. Academy of Management Review, 24(1), 13–30.
Morgenroth, O., & Schaller, J. (2004). Zwischen Akzeptanz und Abwehr: Psychologische Ansichten zum Scheitern. In M. Junge & G. Lechner (Hrsg.), Scheitern. Aspekte eines sozialen Phänomens (S. 181–198). VS Verlag.
Seligman, M. E. P. (1990). Learned Optimism: How to Change Your Mind and Your Life. Knopf.
Shepherd, D. A. (2003). Learning from business failure: Propositions of grief recovery for the self-employed. Academy of Management Review, 28(2), 318–328.
Staw, B. M. (1997). The escalation of commitment: An update and appraisal. In Z. Shapira (Ed.), Organizational decision making (S. 191–215). Cambridge University Press.
Fühlst du dich hin und wieder schuldig?
Schuld?
du möchtest mehr erfahren?
dann meld dich jetzt zu unserem Newsletter an
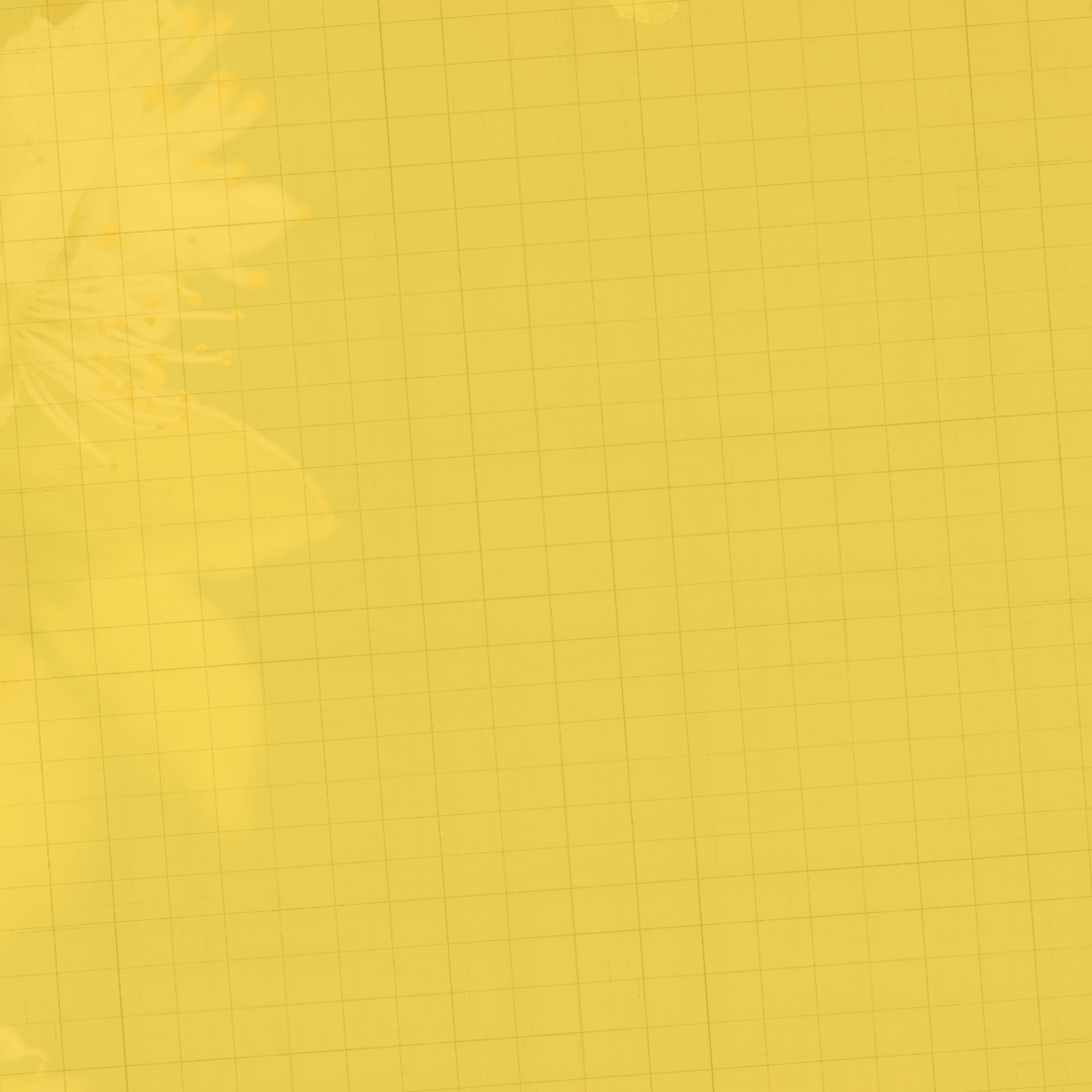
Verbindung
Kreative Plattform für Kunst und Austausch.
© 2024. All rights reserved.
weitere Infos folgen - so weit sind wir noch nicht


